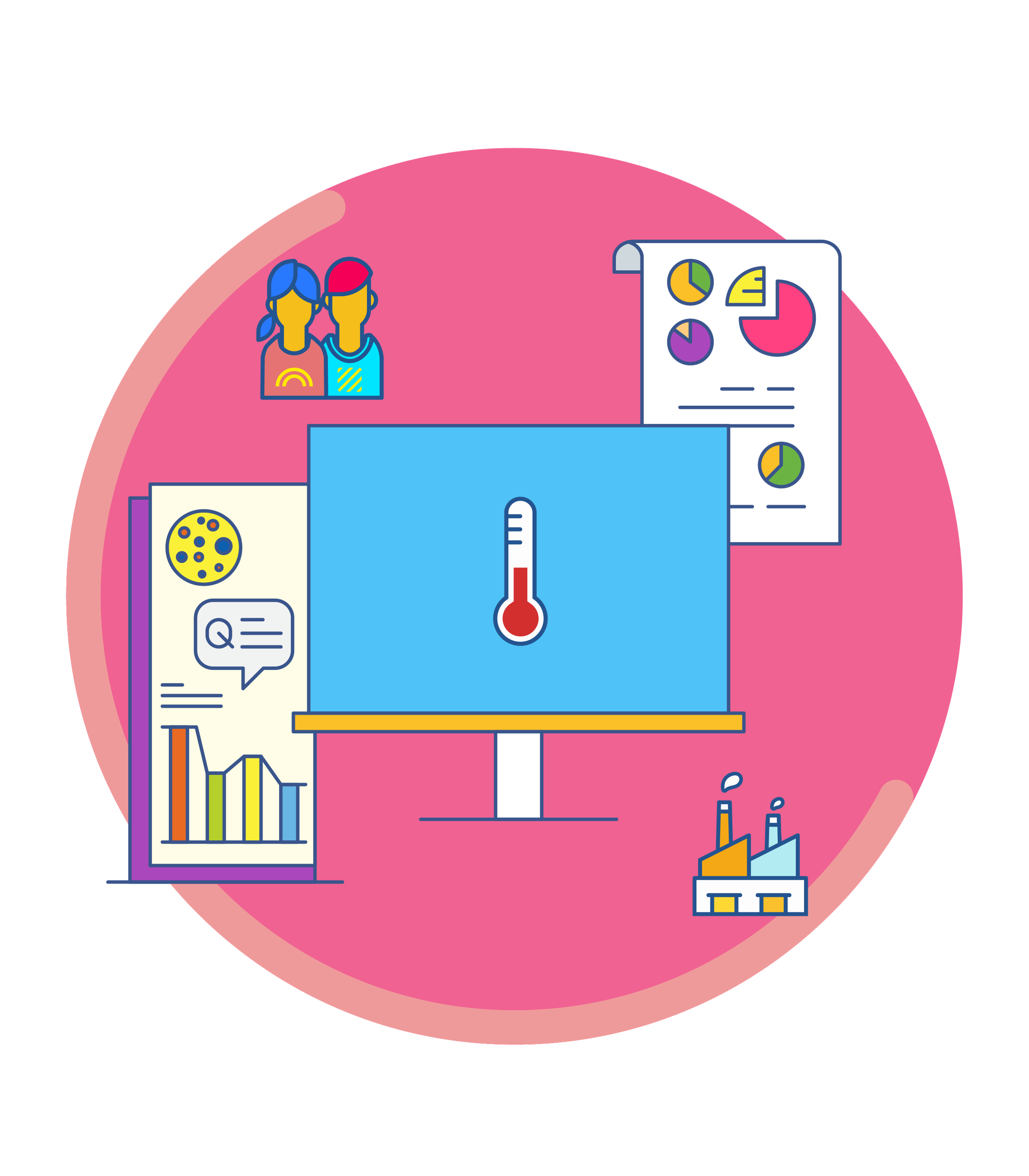
Nahtstellenbarometer 2020
Zentrale Ergebnisse August 2020
Umfrage bei Jugendlichen und Unternehmen im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
Studienziele und -design
Ziel des Nahtstellenbarometers ist die Erfassung von Bildungsentscheiden von Jugendlichen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit und das Einschätzen der Situation auf dem Schweizer Lehrstellenmarkt. Zu diesem Zweck wird jährlich eine dreisprachige Online-Umfrage in zwei Erhebungswellen (April und August) bei Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren und Unternehmen mit mindestens 2 Angestellten durchgeführt.
Vorliegender Kurzbericht liefert einen Überblick über zentrale Ergebnisse der zweiten Erhebungswelle von 2020.
Den Kurzbericht zur April-Umfrage finden sie unter folgendem Link: Cockpit April 2020.
Die Erhebung der April-Umfrage startete vor dem Lockdown vom 16. März 2020. Erst auf Basis der hier vorliegenden Ergebnisse der August-Umfrage sind somit Aussagen zu Auswirkungen von Corona auf den Lehrstellenmarkt möglich.
Die Ergebnisse der zweiten Umfragewelle von 2020 basieren auf einer repräsentativen Befragung von 1’885 Jugendlichen, und 3’370 Unternehmen in der ganzen Schweiz. Details zur Methode finden sich am Schluss dieses Cockpits.
Der ausführliche Forschungsbericht wird Mitte November 2020 vorliegen.
Das Wichtigste in Kürze
Jugendliche
Von den 72’392 Jugendlichen, die im Sommer 2020 ihre obligatorische Schulzeit abschlossen, haben 44 Prozent eine berufliche Grundbildung begonnen und 40 Prozent den allgemeinbildenden Weg eingeschlagen. 14 Prozent mussten auf eine Zwischenlösung ausweichen: davon sind 10 Prozent in Brückenangebote eingetreten und 4 Prozent realisieren ein Zwischenjahr. Wichtig anzumerken ist, dass hier nur ein Teil der Nachfrage nach Lehrstellen abgebildet ist, nämlich jene von 14-16-Jährigen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit.
Seit 2018 zeichnet sich dabei ein Trend weg von der beruflichen Grundbildung, hin zum allgemeinbildenden Weg ab, während Brückenangebote und Zwischenjahre stabil gewählt werden.
Die Corona-Krise hatte Auswirkungen auf die Jugendlichen an der Nahtstelle I, sie sind aber nur für Wenige zu einer echten Herausforderung geworden. 19 Prozent geben zwar an, dass die Corona-Krise ihre Ausbildungswahl erschwert habe. Drei Viertel erhielten aber ausreichend Unterstützung bei der Ausbildungswahl und stabile 84 Prozent konnten trotz allfälliger Hindernisse letztlich mit ihrer Wunschausbildung starten.
Unternehmen
24 Prozent der hier befragten Unternehmen bilden Lehrlinge aus. 92 Prozent der 2020 vergebenen Lehrstellen sind Ausbildungen, die zu einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) führen, bei den übrigen 8 Prozent handelt es sich um berufliche Grundbildungen mit Berufsattest (EBA).
Der Grossteil der 24 Prozent ausbildender Unternehmen, die an der Umfrage teilnahmen, hat das Lehrstellenangebot verglichen mit 2019 konstant gehalten (72%). 11 Prozent der Unternehmen bieten mehr Lehrstellen an als im Vorjahr, 8 Prozent weniger.
90% der 2020 angebotenen Lehrstellen konnten besetzt werden. Vordergründig scheint der Problemdruck durch Corona in Bezug auf die Lehrstellensituation damit auch bei ausbildenden Unternehmen nicht massiv. Dass gemäss eigenen Angaben 45 Prozent von ihnen von Kurzarbeit betroffen waren, verweist aber durchaus auf direkte Auswirkungen der Pandemie auf die Unternehmen.
Situation Schweizer Lehrstellenmarkt
90 Prozent der angebotenen Lehrstellen konnten bis August 2020 besetzt werden. Agiles Verhalten der Unternehmen und Bekenntnis zur Lehrlingsausbildung in der Krisensituation (Blitzbewerbungen, verlängerte Bewerbungsfristen usw.) dürften eine ’normale‘ Lehrstellenvergabe auch 2020 weitgehend ermöglicht haben. Der Umstand jedoch, dass die klare Mehrheit der Lehrverträge in der Deutschschweiz bereits vor dem Lockdown unterschrieben wurde, ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Auswirkungen der Krise wohl erst im kommenden Jahr abschliessend beurteilen lassen werden.
Die Lage auf dem Schweizer Lehrstellenmarkt kann nicht abschliessend bewertet werden, da Bewerber*innen die älter als 16 Jahre sind – und somit später als die hier befragten Jugendlichen in den Lehrstellenmarkt eintreten – im Nahtstellenbarometer nicht erfasst sind. Lediglich 31 Prozent der gesamthaft angebotenen Lehrstellen wurden von Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren belegt, die im Sommer 2020 die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben.

Jugendliche an der Nahtstelle I
Allgemeine Befindlichkeit der Jugendlichen an der Nahtstelle I
Grundsätzlich ist die Zufriedenheit mit dem eingeschlagenen Ausbildungsweg auch 2020 hoch: Die Ausbildungswahl war für die überwiegende Mehrheit eine freie Entscheidung (92% trifft eher oder voll und ganz zu) und sie entspricht den eigenen Fähigkeiten und Interessen (92%). Auch freuen sich die befragten Jugendlichen in grosser Mehrheit auf ihre Ausbildung (91%) und beschreiben sie gar als Traumausbildung oder Wunschlösung (82%).
Viel wurde über den Einfluss der Corona-Krise auf die Ausbildungswahl der Jugendlichen spekuliert und auch die Umfrage verweist auf einen gewissen Problemdruck – jedoch keinen umfassenden.
Für 19 Prozent der Jugendlichen trifft beispielsweise zu, dass die Corona-Krise ihre Ausbildungswahl erschwert habe. Drei Viertel der Jugendlichen geben jedoch an, trotz des Lockdowns und der weiteren Einschränkungen genügend Unterstützung bei der Ausbildungswahl erhalten zu haben.
Die Krise hatte somit für einige Jugendliche an der Nahtstelle I sehr direkte Folgen auf ihre Ausbildungswahl (bspw. konnte rund jede 10. Schnupperlehre nicht stattfinden), im Grossen und Ganzen scheint sie aber durch den Umstand, dass ein Grossteil der Lehrverträge in der Deutschschweiz bereits vor dem Lockdown abgeschlossen wurden und durch die ergriffenen Massnahmen abgefedert worden zu sein.
So zeigt sich die Mehrheit der Jugendlichen optimistisch in Bezug auf die eigene Zukunft. Verhaltener sind jedoch die Voten in Bezug auf die Zukunft der Gesellschaft als Ganzes.
Ausbildungswahl nach obligatorischer Schulzeit
Eine berufliche Grundbildung – sei es in Form einer Lehre (29’011/40%) oder einer schulischen Lösung (2’766/4%) – bleibt die am häufigsten gewählte Option nach der obligatorischen Schulzeit. Junge Männer wählen diesen Weg mehrheitlich (54%), junge Frauen dagegen lediglich zu einem Drittel. Sie ziehen den allgemeinbildenden Weg vor (Frauen: 47%, Männer: 35%), sind aber auch häufiger in Brückenangeboten (Frauen: 14%, Männer: 7%) oder Zwischenlösungen (Frauen: 5%, Männer: 3%) anzutreffen als Männer.
Während sich der Anteil Jugendlicher in Zwischenangeboten insgesamt als stabil erweist, zeichnet sich bei 14- bis 16-Jährigen seit den ersten Erhebungen in 2018 ein Trend weg von der beruflichen Grundbildung, hin zum allgemeinbildenden Weg ab.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass auch im Krisenjahr 2020 84 Prozent der Jugendlichen mit der ersten Wahl für ihre Ausbildung starten konnten.
7 Prozent mussten auf ihre zweite Priorität ausweichen und seit 2018 machen stabile 9 Prozent etwas anderes als ihre erste oder zweite Priorität. In dieser letzten Gruppe zeigt sich allenfalls ein Effekt der Corona-Krise, denn wer nicht mit seiner präferierten Ausbildung starten konnte, gibt klar häufiger an, nun nichts zu machen respektive arbeitslos zu sein (2018: 0%, 2019: 1%, 2020: 11%).
Berufliche Grundbildung
Unter der Kategorie berufliche Grundbildung (31’777) finden sich Jugendliche, die eine Berufslehre beginnen (29’011/91%), und solche, die eine schulische berufliche Grundbildung (2’766/9%) starten, zusammengefasst. Letztere bleiben klar in der Minderheit, das Verhältnis erweist sich als stabil über die Zeit.
Die meisten Jugendlichen beginnen eine drei- oder vierjährige Lehre (57% resp. 41%), welche mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen wird. 2020 hat sich diese an sich stabile Verteilung erstmals bewegt: Es finden sich mehr Lernende, die eine vierjährige Lehre antreten (2018: 34%, 2019: 33%).
Lehren mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) bleiben mit 2 Prozent die Ausnahme (2018: 3%, 2019: 2%).
Deutlich angestiegen ist unter Neu-Lernenden 2020 auch die Absicht, parallel zur Lehre eine Berufsmaturität zu machen. 30 Prozent sehen dies vor. 2018 waren es deren 21, 2019 deren 20 Prozent. Häufigster Grund für eine Berufsmaturität bleibt die Aussicht auf bessere Karrierechancen. Häufigster Grund dagegen die Absicht, erst nach der Lehre eine Berufsmaturität zu realisieren.
Die Top 10 Lehrberufe sind 2020 folgende:
Unter den Neu-Lernenden finden sich erneut mehr Männer (18’392/63%) als Frauen (10’618/37%), wobei sich die Schere 2020 erstmals weiter zu öffnen scheint (2018/2019: 59%/58% Männer und 41%/42% Frauen).
Und es bestätigen sich auch 2020 deutliche Unterschiede in den Lehrberuf-Präferenzen der Geschlechter. Neben dem Spitzenreiter, der bei beiden Geschlechtern gleich ausfällt, findet sich ein einziger Lehrberuf in beiden Listen wieder: Zeichner*in.
Top 10 Lehrberufe Frauen
Kauffrau
Fachfrau Gesundheit
Pharma-Assistentin
Medizinische Praxisassistentin
Dentalassistentin
Detailhandelsfachfrau
Köchin
Fachfrau Betreuung
Hotelfachfrau
Zeichnerin
Top 10 Lehrberufe Männer
Kaufmann
Informatiker
Polymechaniker
Elektroinstallateur
Zeichner
Automatiker
Schreiner
Zimmermann
Automobil-Fachmann
Mediamatiker
Durchschnittlich haben Neu-Lernende 7.1 Bewerbungen verfasst. Das sind weniger als in den Vorjahren (2018: 8.2, 2019: 10.3). Dieser Wert variiert allerdings beträchtlich in den verschiedenen Untergruppen. So verfassten Ausländer*innen 2020 im Schnitt 11.2 Bewerbungen, Schweizer*innen dagegen nur 6.3. Zurückgegangen sind aber nicht die Zusagen auf solche Bewerbungsbestrebungen (2018: 2.0, 2019: 2.1, 2020: 1.9) oder ausstehende Bescheide (2018: 0.8, 2019: 2.0, 2020: 1.0), sondern vielmehr die Absagen (2018: 5.4, 2019: 6.2, 2020: 4.2).
Den Lehrvertrag hatte die Mehrheit der Neu-Lernenden bereits vor dem „Lockdown“ unter Dach und Fach (Schweiz: 64%, Deutschschweiz: 68%, italienisch- und französischsprachige Schweiz: 39%) und die Mehrheit gibt auch an, dass die Corona-Krise keinen Einfluss auf ihren Bewerbungsprozess gehabt habe (82%). Allerdings konnte rund jede Zehnte Schnupperlehre nicht durchgeführt werden.
Lehrvertragsauflösungen sind klar die Ausnahme. Nur 3 Prozent der Jugendlichen, die im Rahmen der April-Umfrage noch eine Lehre in Betracht gezogen haben, waren von einer solchen betroffen. 38 Prozent von ihnen geben aber an, dass die Lehrvertragsauflösung im Zusammenhang mit der Corona-Krise stand.
Mittelschulen
Insgesamt haben 29’293 Jugendliche nach den Sommerferien eine Mittelschule begonnen. 22’007 (75%) von ihnen besuchen ein Gymnasium oder eine Kantonsschule, 7’286 (25%) eine Fachmittelschule. Die Verteilung auf diese beiden Typen von Mittelschulen erweist sich gegenüber dem Vorjahr als stabil.
Auch 2020 haben mehr Frauen (16’270/56%) mit einer Mittelschule begonnen als Männer (13’023/44%). Auch an diesem Verhältnis hat sich über die Zeit nichts verändert.
Der Grossteil der Maturitätsschüler*innen konnte an der Schule, die sie besuchen, den Schwerpunkt ihrer Wahl im Angebot finden (78%). Dieser Wert liegt zwar tiefer als am Vorjahr (2019: 88%), von einem eindeutigen Trend kann jedoch nicht die Rede sein (2018: 73%).
Die am häufigsten gewählten Schwerpunkte sind für Gymnasien und Fachmittelschulen untenstehend abgebildet. Während 2020 vermehrt ein gymnasialer Schwerpunkt in den Bereichen Physik und Mathematik gewählt wurde, haben das neusprachliche Profil sowie Schwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft und Recht kontinuierlich weniger Zulauf. Auffällig ist, dass 2020 mehr Gymnasiasten ihren Schwerpunkt noch nicht festgelegt haben.
Die Schwerpunktwahl in Fachmittelschulen folgt keinen eindeutigen Trends. Spitzenreiter bleibt der Schwerpunkt Gesundheit.
Als zentral für die Schwerpunktwahl erweist sich neben dem Interesse die Frage, ob ein spezifischer Schwerpunkt eine gute Vorbereitung für ein nachfolgendes Studium ist. Auch die schulischen Stärken und Schwächen sind wegweisend.
Brückenangebote
7’476 Jugendliche oder stabile 10% nehmen 2020 im Anschluss an die obligatorische Schulzeit ein Brückenangebot wahr. Für die meisten von ihnen fällt die Wahl auf rein schulische Angebote und das zunehmend (2018: 33%, 2019: 41%, 2020: 48%). Frauen (67%) sind 2020 klar häufiger in Brückenangeboten als Männer (33%). Das war 2019 noch nicht der Fall (Frauen: 47%, Männer: 53%) und dürfte den Zuwachs in schulischen Angeboten mitunter erklären.
Der häufigste Grund, weshalb ein Brückenangebot wahrgenommen wird, ist, dass keine passende Lehrstelle gefunden wurde (37%). Gegenüber dem Vorjahr wurde dieser Grund jedoch weniger oft genannt (2018: 60%, 2019: 43%). 18 Prozent geben ausserdem an, dass ihr Entscheid für ein Brückenangebot einen Zusammenhang mit der Corona-Krise hatte.
Deutlich kommt zum Ausdruck, dass die meisten Jugendlichen in Brückenangeboten danach eine Berufslehre beginnen möchten. Ebenfalls stabile 11 Prozent möchten danach an eine Mittelschule.
Zwischenjahr
Ein Zwischenjahr nach der obligatorischen Schulzeit bleibt die Ausnahme. 4 Prozent (3’081) der Jugendlichen realisieren aktuell ein solches. Erneut befinden sich darunter deutlich mehr Frauen (1’865/61%) als Männer (1’216/39%), wobei sich die Geschlechterdifferenz über die Zeit verringert hat (Frauen 2018/2019: 77%/66%, Männer 2018/2019: 23%/34%).
Gründe für Zwischenlösungen sind so verschieden, wie die Zwischenlösungen selber, was in der Sammelkategorie ‚andere Gründe‘ zum Ausdruck kommt. Inhaltlich werden am häufigsten mehr Zeit für sich haben zu wollen sowie eine erfolglose Lehrstellensuche als Gründe für ein Zwischenjahr genannt. Der Wunsch nach mehr Zeit für sich wird dabei häufiger genannt als in den Vorjahren.

Lehrstellensituation der Unternehmen
Lehrstellenangebot und -vergabe
24% der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, bieten Lehrstellen an.
90% dieser Lehrstellen konnten Stand August 2020 besetzt werden. Der Trend verweist für 2020 auf keine speziellen Schwierigkeiten bei der Lehrstellenvergabe. Es sind ähnlich viele Lehrstellen besetzt worden wie zum gleichen Zeitpunkt in den Vorjahren (2018: 86%, 2019: 88%).
8% der angebotenen Lehrstellen sind EBA-Lehren, 92% sind EFZ-Lehren. Dieses Verhältnis erweist sich als relativ stabil über die Zeit (2018: 7%/93%, 2019: 9%/91%).
Die Aufschlüsselung der Lehrstellensituation nach Branchen liefert untenstehende Grafik.
In den Bereichen Handel sowie Gesundheit- und Sozialwesen wurde das Lehrstellenangebot ausgebaut. Wachstum in Bezug auf das Lehrstellenangebot findet sich ausserdem bei der öffentlichen Verwaltung, im Bereich Erziehung und Unterricht sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen. Im Baugewerbe finden sich hingegen immer weniger Lehrstellen. Auch im verarbeitenden Gewerbe hat sich das Angebot im Vergleich zum Vorjahr verringert.
Erhöhte Schwierigkeiten bei der Vergabe von Lehrstellen zeigen sich in der Handelsbranche, im Baugewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen, wo im August 2020 rund jede fünfte Lehrstelle unbesetzt blieb, im verarbeitenden Gewerbe war es fast jede Zehnte.
Im Baugewerbe, im Handel, in der Landwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe aber auch im Gastgewerbe bleiben seit 2018 kontinuierlich weniger Lehrstellen offen.
Ein deutlicher Anstieg offener Lehrstellen zeigt sich 2020 dagegen für das Sozial- und Gesundheitswesen und den Bereich freiberufliche Dienstleistungen.
Gründe und Lösungen für offengebliebene Lehrstellen
Am häufigsten blieben Lehrstellen 2020 wegen ungeeigneten oder fehlenden Bewerbungen unbesetzt. Während ersteres über die Zeit weniger ein Problem darstellt, setzt sich der Trend hin zu einem generellen Rückgang an Bewerbungen 2020 nicht weiter fort.
18 Prozent der Unternehmen geben als Grund für offengebliebene Lehrstellen zudem an, dass Rekrutierungsverfahren wegen Corona nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden konnten.
Die Problemlage bleibt bei EFZ- und EBA-Stellen eine andere: Auf EBA-Stellen bewerben sich primär zu wenige Kandidat*innen, während es bei EFZ-Stellen vorrangig ungeeignete Kandidat*innen sind.
Offengebliebene Lehrstellen zu streichen oder nicht mehr auszuschreiben bleibt die Ausnahme. Die meisten vakanten Lehrstellen sollen nächstes Jahr wieder ausgeschrieben werden (75%).
Gestiegen ist 2020 vor dem Corona-Hintergrund die Absicht, Lehrstellen weiter offen zu halten, um sie allenfalls noch besetzen zu können (2018: 52%, 2019: 50%, 2020: 66%).
Profil der Neu-Lernenden
Es bleibt dabei, dass sich unter den Lernenden, die im Sommer 2020 eine Lehre begonnen haben, mehr Männer als Frauen finden (Männer: 56%, Frauen: 44%). Dieses Geschlechterverhältnis erweist sich als weitgehend stabil über die Zeit.
Seltener sind Neu-Lernende 2020 jedoch älter als 16 Jahre. Traf dies 2018 und 2019 jeweils für gut die Hälfte der Neu-Lernenden zu (51%/49%), sind es aktuell nur noch 37 Prozent. Nichtsdestotrotz zeigt sich an dieser Stelle, dass längst nicht jede Lehre im unmittelbaren Anschluss an die obligatorische Schulzeit angetreten wird.
Stabile 8 Prozent der Lehrstellen werden an Personen vergeben, die bereits über einen EBA- oder EFZ-Abschluss verfügen.
Die Möglichkeit neben der Arbeit eine Berufsmaturität zu realisieren bietet weiterhin die Mehrheit der Lehrbetriebe an (2020: 58%). Wahrgenommen wird diese Möglichkeit jedoch nur von stabilen 6 Prozent der Neu-Lernenden. Dieser Wert variiert jedoch beträchtlich in den verschiedenen Branchen. Am häufigsten streben Neu-Lernende aus dem Finanz- und Versicherungswesen (24%), dem verarbeitenden Gewerbe (17%) und solche im Bereich freiberuflicher Dienstleistungen (15%) eine Berufsmaturität an.
Veränderung Lehrstellenangebot
Die meisten Unternehmen geben an, ihr Lehrstellenangebot gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten zu haben. Die Anteile Unternehmen, die mehr oder weniger Lehrstellen anbieten, haben sich kaum verändert.
Die Corona-Krise hatte dabei Einfluss auf beide Entscheidungen. Lehrbetriebe, die 2020 weniger Lehrstellen anbieten als im Vorjahr, geben vermehrt an, dies aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage zu tun (2018: 10%, 2019: 11%, 2020: 20%). Häufigster Grund bleiben aber natürliche Fluktuationen (2018: 53%, 2019: 46%, 2020: 45%).
Lehrbetriebe die angeben, mehr Lehrstellen anzubieten als noch 2019, geben zu 15 Prozent an, trotz Corona eine Perspektive bieten zu wollen. Häufigster Grund für mehr Lehrstellen bleibt aber die Sorge um den Berufsnachwuchs (2018: 36%, 2019: 36%, 2020: 41%).
Für das kommende Jahr 2021 präsentiert sich die Situation offener. Zwar möchte die Mehrheit der ausbildenden Unternehmen ihr Angebot trotz der aktuellen Wirtschaftslage und Befürchtungen der Auswirkungen von Corona weiterhin konstant halten. Auffallend viele üben in dieser Frage aber Zurückhaltung und geben an, dass der Entscheid noch offen sei.
Lehrabschlüsse
Die meisten Lehrabgänger*innen absolvierten ihre Lehre bei Grossunternehmen mit über 100 Mitarbeitern (50%) oder bei Unternehmen mittlerer Grösse (32%).
Die höchsten Anteile an Lehrabgänger*innen vereinen das Gesundheits- und Sozialwesen, die Handelsbranche und das verarbeitende Gewerbe.
Erstere beiden Branchen gehören zusammen mit den Bereichen Information und Kommunikation, der öffentlichen Verwaltung, der Finanz- und Versicherungsbranche und dem Bereich Erziehung und Unterricht eindeutig zu den wachsenden Ausbildungsbranchen.
Kontinuierlich weniger Abgänger*innen finden sich dagegen im Baugewerbe, der Unterhaltungsbranche und im Verkehrswesen.
Die meisten Lehrabgänger*innen verlassen 2020 das Unternehmen, in welchem sie ihre Lehrzeit verbracht haben. Ein Drittel wird im Lehrbetrieb fest angestellt, 16 Prozent temporär.
Gegenüber dem Vorjahr haben Festanstellungen etwas abgenommen und Abgänge zugenommen. Die Werte bewegen sich damit wieder im 2018 festgehaltenen Bereich und verweisen auch an dieser Stelle auf keine massiven Verschiebungen wegen der Pandemielage.
Untenstehend finden sich die Anteile von Festanstellungen pro Branche über die Zeit. Die dynamischen Entwicklungen sind heterogen. Von einem branchenübergreifenden Trend kann entsprechend nicht die Rede sein.
Die Branche mit der grössten Anzahl Abgänger*innen – das Gesundheits- und Sozialwesen – stellt gleich viele Lehrabgänger*innen fest an, wie in den beiden Vorjahren. In der zweitgrössten Branche punkto Abgänger*innen – der Handelsbranche – ist ein Plus an Festanstellungen zu verbuchen. Anders im verarbeitenden Gewerbe, der drittstärksten Abgänger*innen-Branche. Hier wurden seit 2018 kontinuierlich weniger Festanstellungen an Lehrabgänger*innen vergeben. Gleiches gilt für das Baugewerbe, die Finanz- und Versicherungsbranche und freiberufliche Dienstleistungen.
Technische Eckdaten
Wichtiger Hinweis:
Bei den ausgewiesenen Absolutwerten handelt es sich um hochgerechnete Werte. Die Stichprobenergebnisse wurden auf die Grundgesamtheit hochgerechnet.
Die Hochrechnung der Jugendlichen basiert auf den Jugendlichen, die gemäss Statistik der Lernenden (Bundesamt für Statistik) im Vorjahr die 8. Klasse besucht haben.
Auf eine Hochrechnung der Unternehmen wurde 2020 verzichtet.
Jugendliche
Zielgruppe: 14-16-jährige Einwohner*innen, die an der April-Umfrage teilgenommen haben und die obligatorische Schulzeit im Sommer abgeschlossen haben
Adressbasis: Stichprobenrahmen des Bundesamtes für Statistik
Befragungsmethode: schriftliche Befragung (online)
Befragungszeitraum: 20.07. – 02.09.2020
Total Befragte: N = 1’885
Fehlerbereich: ± 2.2 Prozent bei 50/50 und 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit
Ausschöpfung: 65%
Gewichtung: Stufe 1: Anzahl Jugendliche nach Kanton; Stufe 2: Alter/Geschlecht verknüpft pro Kanton
Unternehmen
Zielgruppe: Unternehmen mit mindestens 2 Mitarbeitenden, die an der April-Umfrage teilgenommen haben
Adressbasis: Unternehmensregister des Bundesamtes für Statistik
Befragungsmethode: schriftliche Befragung (Online/Papier)
Befragungszeitraum: 20.07. – 07.09.2020
Total Befragte: N = 3’370
Fehlerbereich: ± 1.7 Prozent bei 50/50 und 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit
Ausschöpfung: 71%
Gewichtung: Stufe 1: Anzahl Unternehmen nach Sprachregion; Stufe 2: Unternehmen nach Noga-Codes verknüpft pro Sprachregion
Projektteam gfs.bern
Lukas Golder: Politik- und Medienwissenschaftler
Martina Mousson: Politikwissenschaftlerin
Aaron Venetz: Politikwissenschaftler
Externe Beratung
Prof. Dr. Stefan C. Wolter, Professor für Bildungsökonomie, Universität Bern